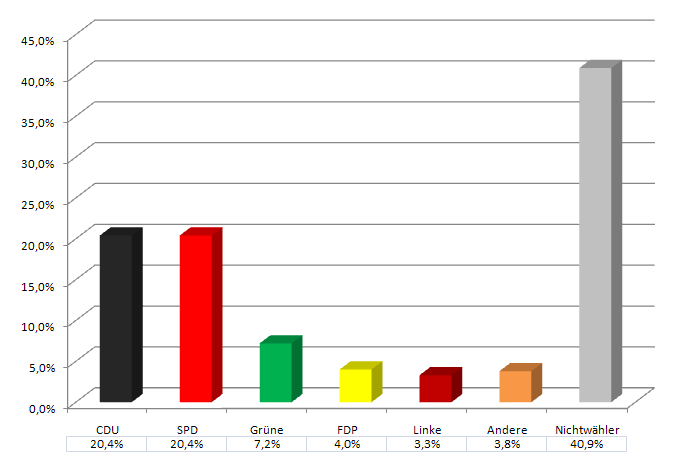Am Montagabend habe ich an einer kleinen Expertenrunde zum Thema Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) teilgenommen. Eingeladen hatte Daniel Bär von den Kölner Jusos, um in einem kleinen Kreis mit Marc Jan Eumann, Staatssekretär in NRW und Vorsitzender der Medienkommission der SPD über den JMStV zu diskutieren. Geladen waren eine Auswahl von Netzaktiven und Jusos, die sich mit dem Thema befassen. Über unsere Einladung habe ich mich sehr gefreut.
Zufälligerweise waren alle geladenen externen Experten entweder Piraten oder den Piraten freundschaftlich verbunden. Anwesend war Jürgen Ertelt (@ertelt), Medienpädagoge von Jugend-Online (IJAB), Dominik Boecker (@domainrecht), Fachanwalt für Informationstechnologierecht aus Köln und aktiv im AK Zensur, Kai Schmalenbach (@dave_kay), Sysadmin und mit dem JMStV befasster Pirat aus Düsseldorf, und meine Wenigkeit als Vorstandsvorsitzender des KV Köln der Piraten und als Internetunternehmer (@netnrd). Von den SPD-Jusos waren 5 Personen anwesend, neben dem Gastgeber Daniel Bär (@danielbaer) u.a. auch der Blogger Jens Matheuszik vom Pottblog (@pottblog).
Interessanterweise lehnten alle Anwesenden (außer Herrn Eumann selbst) den JMStV-Entwurf in der vorliegenden Form ab. Auch die Jusos sprechen sich einstimmig gegen die Annahme dieses Vertrages aus.
Eumann stellte zunächst die Situation in groben Zügen dar. Er ging kurz auf das Konstrukt „Staatsvertrag“ ein, und stellte heraus, dass den Landesparlamenten hier nur die Annahme oder die Ablehnung im Ganzen zur Verfügung steht.
Seiner Einschätzung nach werden die CDU-Abgeordneten im Landtag zustimmen, und auch die Mehrheit der SPD-Abgeordneten ist wohl dafür. Ich persönlich vermute, dass es sehr stark von der Empfehlung Eumanns abhängt, wie sich die Fraktion entscheiden wird, da sein Wort in diesem Thema ganz sicher Gewicht haben wird. Ich würde mir wünschen, er würde seine Ansicht überdenken…
Die Grünen werden auch zustimmen, das schloss er aus den auch uns bekannten Äußerungen im Sinne von „Pacta sunt servanda“. Darüber haben sich Piraten an anderer Stelle schon beklagt – doch das ist ein Thema für sich.
Er hält den neuen Vertrag für besser als den derzeit gültigen, jedoch stimmt er in uns darin überein, dass auch der neue noch nicht wirklich gut ist. Seiner Ansicht nach ist der Jugendschutz ein kulturelles gesellschaftliches Gut, den Jugendschutz im Internet solle man nicht aufgeben. Er stellte die Alternativfrage, was denn besser sei als das vorliegende Modell, oder ob man den Jugendschutz im Internet etwa aufgeben solle.
Ihm ist klar, dass keine Filtersoftware absolut sicher sein wird, und dass die meisten Kinder in einem Alter von ca. 11 Jahren technisch versiert genug sein werden, diesen Filter zu umgehen. Genauso wenig stellt er außer Frage, dass die Filtersoftware nicht alle Eltern erreichen wird, da vielen die technischen Fähigkeiten zur Administration eines Computers fehlen werden.
Seiner Meinung nach ist ein schlechter oder lückenhafter Filter immer noch besser als keiner – damit zwar in Widerspruch zu unserer Meinung, aber eine nachvollziehbare und verständliche Ansicht.
Den Einwand, das Vermittlung von Medienkompetenz mindestens denselben, wenn nicht einen höheren Stellenwert haben müsste als das Propagieren einer unzureichenden technischen Lösung, beantwortete er mit dem Hinweis, dass dies nicht Aufgabe des JMStV sei, sondern als separates Projekt auf der Agenda stünde, und in NRW als eines der Kernthemen im Koalitionsvertrag gelte. Dies ist ein Punkt, welchen die Piraten in NRW genau beobachten sollten, ob die Vermittlung von Medienkompetenz an Schüler, Eltern und Lehrer tatsächlich diesen Raum eingeräumt bekommt, und ob entsprechende Maßnahmen tatsächlich ergriffen werden.
Wir wandten uns auch den Seiteneffekten des Filters zu. So setzt die Filtersoftware auf einer freiwilligen Selbstklassifizierung der Webseitenbetreiber auf. Daniel Bär, der die Webseite der Kölner Jusos betreut, nannte es für ihn unmöglich, bereits diese Homepage zu klassifizieren, beispielsweise da er wegen einer Kinoveranstaltung der Jusos einen Trailer eingebaut habe. Ein vergleichbares Problem stellt z.B. die Einstufung der Wikipedia, oder die Einstufung von Web2.0-Seiten mit einem Anteil an von Usern erzeugtem Inhalt generell dar.
Da viele Webseitenbetreiber vor ähnlichen Klassifizierungsproblemen stehen, wird vermutlich oftmals gar keine Klassifizierung durchgeführt, oder sicherheitshalber erst ab 18 freigegeben. Dies wird zu einem Overblocking-Effekt führen. Es werden Kinder am Erwerb von Medienkompetenz gehindert, wenn übermäßig viele Inhalte wie etwa Parteiseiten und Portale vor Ihnen verborgen bleiben. Ausländische Seiten werden ganz überwiegend nicht gerated werden, und sind dadurch Kindern niemals verfügbar. Eltern werden die Software irgendwann genervt ausschalten, wenn sie feststellen, dass zu viele sinnvolle Inhalte für ihre Kinder nicht verfügbar sind.
Auch für Eumann ist Overblocking ein Problem. Er betonte deshalb die im JMStV stehende Vereinbarung, diesen nach drei Jahren zu evaluieren und ggf. anzupassen. Dann könne man die den tatsächlichen Umfang der Filterung und des Einsatzes feststellen.
Natürlich ist drei Jahre im Internet eine Ewigkeit. Jürgen Ertelt forderte daher, dass Evaluation ein kontinuierlicher Prozess sein muss, der quasi von Beginn an vorhanden sein muss.
Was versehentliche Falschklassifikation angeht, oder Falschkassifikation aufgrund von unpassendem user-generated Content, verwies Eumann darauf, dass auf bei versehentlicher oder unbeabsichtigter Falschklassifikation keine strafrechtlichen Konsequenzen folgen. Wie im Telemediengesetz auch haftet man nicht für fremde Inhalte, und hat erst ab Kenntnis zu reagieren, seine Einstufung würde man dann behalten.
Unbekannt war ihm hingegen der wettbewerbsrechtliche Effekt. Eine falsche Altersklassifikation kann Abmahnungen von Wettbewerbern und Wettbewerbshütern nach sich ziehen – eine falsche Einstufung bringt nämlich durch die daraus folgende geringere Filterung einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil, und dieser ist – vollkommen unabhängig vom individuellen Verschulden – immer wettbewerbswidrig und abmahnfähig. Eine Störerhaftung trifft auch einen Anbieter oder Provider. Hier öffnet sich ein vollkommen neues Feld für die Abmahnindustrie. Marc Jan Eumann war ganz offensichtlich überrascht über diesen Aspekt und versprach, dies zu prüfen, er machte sich dazu Notizen. Ich (als selbst betroffener Betreiber von Portalseiten) bin hochgespannt, ob sich in diesem Thema noch etwas bewegt.
Ich persönlich finde es bedauerlich, dass man mit einer staatlich verordneten Filtersoftware eine absehbare Totgeburt produziert, die erhebliche Kosten mit zweifelhaften Erfolg verursachen wird, anstelle auf den Wettbewerb zu setzen und die – bereits vorhandenen – Filterprogramme überprüft, empfiehlt und in der Verwendung dieser schult. Eine klassische Whitelistefilterung für kleine Kinder halte ich für die beste Vorgehensweise, sie kommt auch ohne Klassifizierung durch Webseitenbetreiber selbst aus.
Marc Jan Eumann habe ich als einen sehr sympathischen und offenen Menschen erlebt, der einen erheblichen Sachverstand in den Netzthemen hat (ganz im Gegensatz zu manch anderen „Netzexperten“ der etablierten Parteien). Zwar hält er an dem bestehenden Änderungsantrag fest, er ist aber offenbar aufgeschlossen für die geschilderten Probleme, Seiteneffekte und Auswirkungen. Interessant fand ich seine Feststellung, dass er auch in seinem Ministerium erst einmal Knowhow um Netzthemen aufbauen muss, und dass es offenbar fast keine kompetenten Leute gibt.
Wir haben die Bereitschaft herausgestellt, auch in Zukunft an diesem Prozess teilzunehmen, wir werden versuchen, den Kontakt zu halten. Ich bin sehr gespannt, ob die Dialogbereitschaft bestehen bleibt, ich würde mich freuen. Jetzt wäre es eine Herausforderung, auch mit den NRW-Grünen in einen solchen Dialog einzutreten.
 Es könnte eine Geschichte aus einem Spionage-Thriller sein: Die Regierungen der Welt verhandeln heimlich mit multinationalen Konzernen über die Änderung und Abschaffung von Gesetzen zu deren wirtschaftlichem Wohle, ohne dass Parlamente oder die Bevölkerung darüber informiert sind.
Es könnte eine Geschichte aus einem Spionage-Thriller sein: Die Regierungen der Welt verhandeln heimlich mit multinationalen Konzernen über die Änderung und Abschaffung von Gesetzen zu deren wirtschaftlichem Wohle, ohne dass Parlamente oder die Bevölkerung darüber informiert sind.